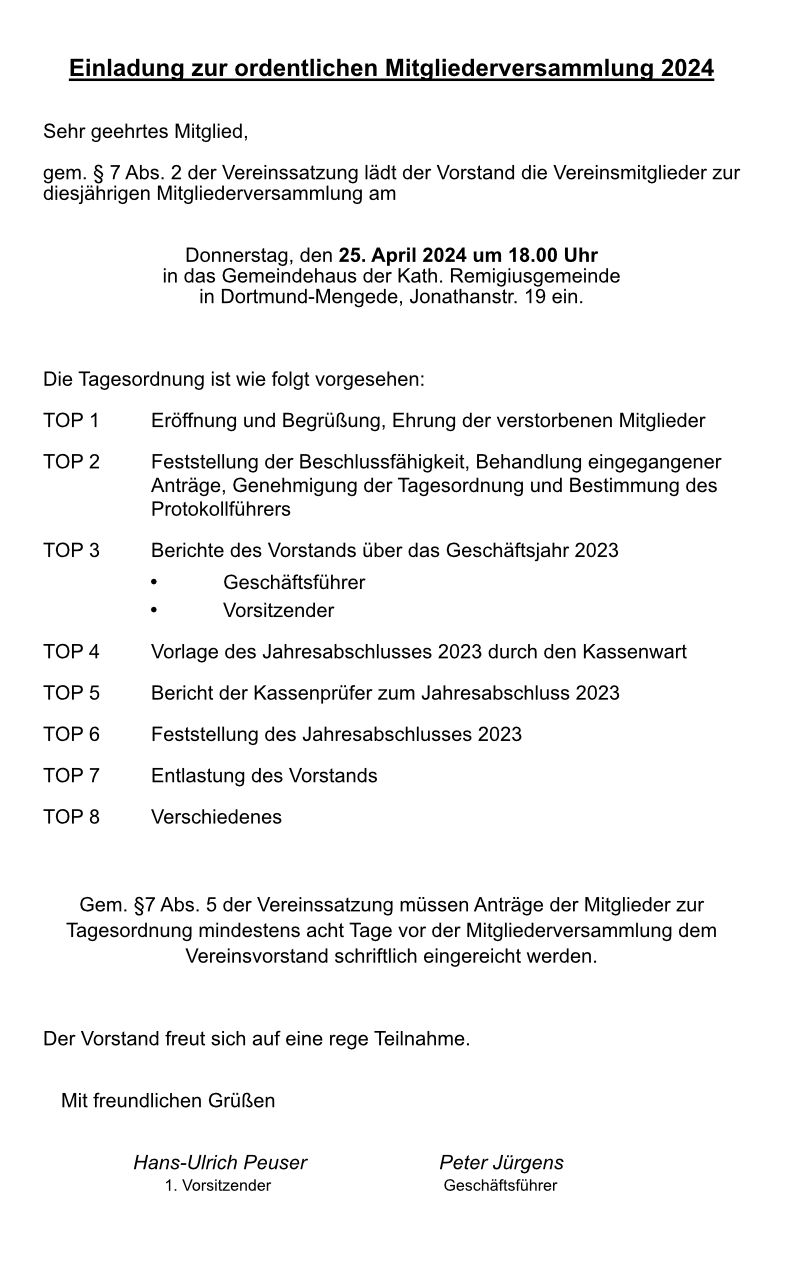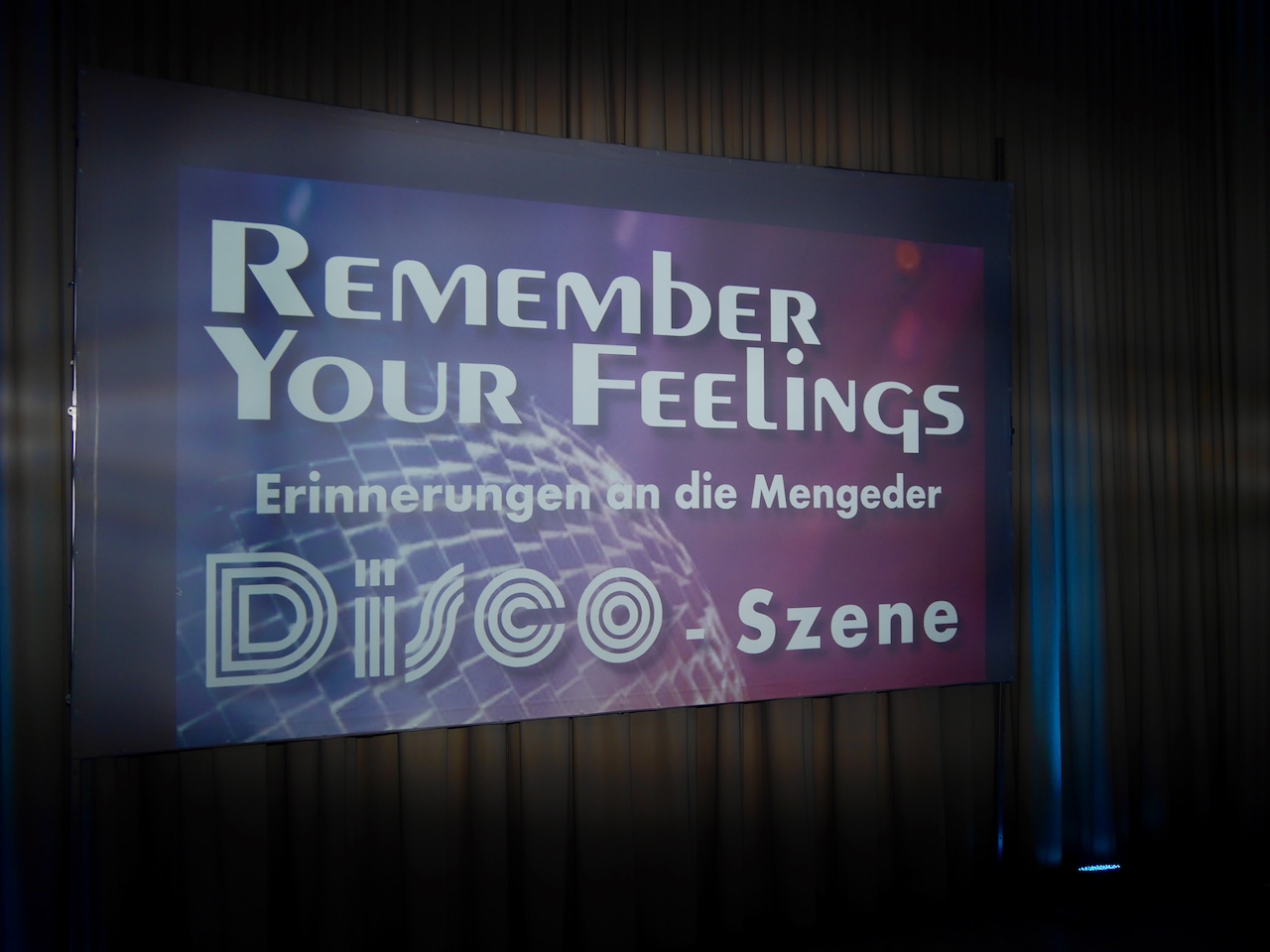Donnerstag, 18.April.2024
Der nächste Termin:
- 25. April 2024, 18:00 Uhr
ordentliche Mitgliederversammlung 2024
Gemeindehaus kath. Remigiuskirche, Jonathanstr. 19 - 1. Mai 2024, 11:00 Uhr
Maibaumfest
Amtshaus Park Mengede - 8. Mai 2024, 18:00 Uhr
Skat und Doppelkopf Abend
Heimathaus am Widum - 9. Mai 2024, 19:00 Uhr
„ Auf’n Pils“ in die Heimatstube
Heimathaus am Widum
Bild des Monats

Foto: Wolfgang Schlesiger
Die Wandergruppe des Heimatvereins trotzte Wind und Regen
Foto: Wolfgang Schlesiger